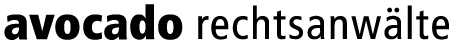EuGH zu interkommunalen Kooperationen: Urteil stärkt Position der Kommunen!
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich bei dem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 09.06.2009 in der Rechtssache Stadtreinigung Hamburg (C-480/06) um eine rein politisch motivierte Entscheidung handelt. So hat der EuGH in seinem Urteil eine weitestmögliche Freistellung interkommunaler Kooperationen vom Vergaberecht angenommen – und verweist dabei überwiegend auf Pauschalaussagen. In der Sache hatten die Landkreise Rothenburg (Wümme), Harburg, Soltau-Fallingbostel und Stade einen Auftrag über Abfallentsorgungsdienstleistungen direkt an die Stadtreinigung Hamburg erteilt, ohne dass dieser Auftrag im förmlichen Verfahren gemeindschaftsweit ausgeschrieben worden ist. Konkret hat sich die Stadtreinigung Hamburg gegenüber den vier niedersächsischen Landkreises verpflichtet, eine Kapazität von 120.000 t/Jahr in einer bestimmten Müllverbrennungsanlage zu reservieren – im Gegenzug haben sich die Landkreise verpflichtet, die Entsorgung der bei ihnen anfallenden Abfälle in der Müllverbrennungsanlage vorzunehmen. Diese Vorgehensweise hat der EuGH nicht beanstandet und weist damit eine Klage der Europäischen Kommission ab.
Entgegen den Schlussanträgen des Generalanwalts Mazà k vom 19.02.2009 – der eindeutig von einem vergabepflichtigen Vorgang ausgegangen ist – hat der EuGH vielmehr für den Fall einer Zusammenarbeit von Gebietskörperschaften bei der Wahrnehmung einer ihnen allen obliegenden öffentlichen Aufgabe – hier der Abfallentsorgung – einen neuen, ungeschriebenen Ausnahmetatbestand entwickelt. Den oftmals in diesem Zusammenhang diskutierten Ausnahmetatbestand des Inhouse-Geschäfts hat der EuGH dagegen eindeutig abgelehnt.
Umgang mit Aufgaben der Daseinsvorsorge
Zunächst stellt der EuGH fest, dass die betroffene Aufgabe der Daseinsvorsorge – der Abfallentsorgung – mit diversen öffentlichen Vorgaben verknüpft sei und insbesondere an dem Autarkieprinzip, wonach der Abfall in einer so nah wie möglich gelegenen Anlage zu verwerten sei, zu messen sei. Gerade die Initiative der Vertragsparteien zur interkommunalen Zusammenarbeit werde den öffentlichen Anforderungen an die Aufgabe der Abfallentsorgung gerecht und garantiere diese Aufgabe unter den bestmöglichen Bedingungen für alle Beteiligten.
Keine spezielle Rechtsform für interkommunale Kooperationen
Während diese Aussagen noch auf den konkreten Fall zugeschnitten sind, hat der EuGH sodann allgemein darauf hingewiesen, dass eine öffentliche Stelle ihre im allgemeinen Interesse liegenden Aufgaben mit ihren eigenen Mitteln und auch in Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Stellen erfüllen könne, ohne gezwungen zu sein, sich an externe Einrichtungen zu wenden, die nicht zu ihren Dienststellen gehörten.
Zuvor hatte die Europäische Kommission in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass sie lediglich die Schaffung einer gemeinsamen Einrichtung des öffentlichen Rechts durch verschiedene Kommunen und deren Beauftragung mit bestimmten Leistungen als vergaberechtsfrei akzeptiert hätte. Ohne eine solche Einrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit müsse allerdings der von den betroffenen Landkreisen an die Stadtreinigung Hamburg vergebene Dienstleistungsauftrag ausgeschrieben werden.
Dieser Auffassung erteilt der EuGH klar eine Absage. Das Gemeinschaftsrecht schreibe den öffentlichen Stellen für die gemeinsame Wahrnehmung ihrer öffentlichen Aufgaben keine spezielle Rechtsform vor. Außerdem könne eine solche Zusammenarbeit öffentlicher Stellen das Hauptziel der Gemeinschaftsvorschriften über das öffentliche Auftragswesen – einen freien Dienstleistungsverkehr und die Eröffnung eines unverfälschten Wettbewerbs in allen Mitgliedstaaten – nicht in Frage stellen. Dies gelte jedenfalls dann, sofern die Umsetzung der Zusammenarbeit nur durch Überlegungen und Erfordernisse bestimmt werde, die mit der Verfolgung von im öffentlichen Interesse liegenden Zielen zusammenhingen, und der in der europäischen Vergaberichtlinie genannte Grundsatz der Gleichbehandlung der Interessenten gewährleistet sei, so dass kein privates Unternehmen bessergestellt werde als seine Wettbewerber. Gegen beide Einschränkungen hatte der EuGH offensichtlich keine Bedenken. Es läge insbesondere kein Hinweis dafür vor, dass die beteiligten Körperschaften in der vorliegenden Rechtssache eine Gestaltung gewählt hätten, mit der das Vergaberecht umgangen werden solle.
Fazit
Das Urteil des EuGH ist für viele private Unternehmen (nicht nur der Entsorgungsbranche) verheerend. Es enthält für Kommunen einen „vergaberechtlichen Freibrief“, Leistungen der Daseinsvorsorge ohne Beteiligung der Privatwirtschaft zusammen mit anderen öffentlichen Stellen zu erfüllen – je nachdem ob dies erwünscht ist oder eben nicht. Dieses Ergebnis gilt umso mehr, als dass die anfänglichen Erwägungen des EuGH zu dem konkreten Sachverhalt hinsichtlich des Argumentes des Autarkieprinzips nicht überzeugen. Denn in der konkreten Situation ging es ausweislich der Feststellungen des Gerichts um Abfälle zur Verwertung, die grundsätzlich nicht dem Autarkieprinzip unterfallen (vgl. auch Art. 16 RL 2008/98/EG – Abfallrahmenrichtlinie). Der EuGH verkennt aber nicht nur die abfallrechtlichen Aussagen in diesem Zusammenhang, sondern setzt sich erst gar nicht mit dem Aspekt auseinander, dass Leistungen der Daseinsvorsorge auch unter Einbindung privater Partner „genauso gut“ und den öffentlich Vorgaben entsprechend erbracht werden können – wie das letzte Jahrzehnt offensichtlich zeigt.
Daher stehen umso mehr die allgemein gehaltenen Argumente des EuGH zur Freistellung interkommunaler Kooperationen im Vordergrund des Urteils. Dogmatisch lässt sich die Entscheidung des EuGH leider nicht nachvollziehen. Bislang wurde in der gesamten Rechtsprechung und Literatur einhellig vertreten, dass eine (entgeltliche) Beauftragung zwischen zwei Kommunen unstreitig die Tatbestandsvoraussetzungen eines öffentlichen Auftrags im Sinne des § 99 Abs. 1 GWB erfüllt und demnach unter das Vergaberecht fällt. Allein für spezielle Fälle der Verwaltungsorganisation – wie beispielsweise Zweckverbandsvorhaben – hat man einen dem Vergaberecht vorgelagerten Akt interner Aufgabenorganisation angenommen. Aus welchen konkreten Gründen der EuGH eine allgemeine Freistellung einer Zusammenarbeit von Gebietskörperschaften bei öffentlichen Aufgaben – also generell im Bereich der Daseinsvorsorge – annehmen will, lässt sich dem Urteil an keiner Stelle erschließen. Äußerst bedenklich ist überdies der Hinweis der europäischen Richter, dass solche Formen der Zusammenarbeit von öffentlichen Stellen den Wettbewerb nicht negativ zu Lasten privater Unternehmen tangierten, da letztlich kein privates Unternehmen besser oder schlechter gestellt sei als seine Konkurrenten. Denn in der Praxis stehen selbstverständlich auch Kommunen bzw. ihre öffentlichen Unternehmen in „attraktiven“ Bereichen der Daseinsvorsorge im Wettbewerb und in Konkurrenz zur privaten (Entsorgungs-) Wirtschaft. Faktisch wird dieses Urteil daher zur Folge haben, dass Kommunen fortan frei wählen können, ob sie „attraktive“ Leistungen der Daseinsvorsorge am Markt vorbei zusammen mit anderen Kommunen realisieren können oder ob sie „freiwillig“ bereit sind, auch die Privatwirtschaft mit ihrem Know-how einzubinden.
Gleichwohl sind noch einige Frage ungeklärt. Umfasst die Zusammenarbeit öffentlicher Stellen beispielsweise auch die Zusammenarbeit von extra zu diesem Zweck gegründeter öffentlicher Unternehmen oder fallen diese als Unternehmungen in privater Rechtsform nicht unter den Begriff der öffentlichen Stellen? Gleichzeitig wird die nationale vergaberechtliche Spruchpraxis zu klären haben, wann Gestaltungen vorliegen, mit denen das Vergaberecht umgangen werden soll. Es bleibt zu hoffen, dass zumindest die nationale Rechtsprechung den Gedanken des Vergaberechts zugunsten eines europaweiten Binnenmarktes ernst nimmt – und trotz der Ausführungen des EuGH die Konstellationen benennt, in denen das Vergaberecht auch bei einer Zusammenarbeit öffentlicher Stellen anzuwenden bleibt, um vor allem eine (zu erwartende) Umgehung des Vergaberechts zu vermeiden.