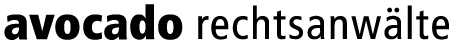Kündigung wegen Versendung privater E-Mails in der Arbeitszeit
Praxistipp
Um zu verhindern, dass Arbeitnehmer während der Arbeitszeit private E-Mails unter Benutzung der betrieblichen Computeranlage schreiben und versenden, muss zunächst der Arbeitgeber die Nutzung der betrieblichen Computer, z.B. durch Regelungen im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung, eindeutig definieren. Die Arbeitnehmer müssen aufgrund dieser Vorgaben im einzelnen erkennen können, welche Tatbestände der privaten Nutzung des betrieblichen Computersystems verboten und welche erlaubt sind. Fehlt eine eindeutige Vorgabe durch den Arbeitgeber, kann eine Kündigung wegen der privaten Nutzung der betrieblichen Computeranlage regelmäßig nur nach einer vorangegangenen Abmahnung wirksam erklärt werden.
Die Einzelheiten
In dem vom LAG Köln verhandelten Fall hatte die betroffene Chef-Sekretärin unter Benutzung ihres Computer-Arbeitsplatzes regelmäßig eine Vielzahl privater E-Mails verfasst und versandt, von denen ein nicht unerheblicher T eil auch sehr umfangreich war. Daneben konnte einigen der von der Arbeitnehmerin erstellten Texte entnommen werden, dass sie den Geschäftsführer des Arbeitgebers für dumm und unfähig gehalten habe. Die betroffene Arbeitnehmerin hatte ihren Computer-Arbeitsplatz mit einem Passwort gesichert, so dass der Arbeitgeber währ end einer Erkrankung der Arbeitnehmerin Zugriff auf die Dateien der Arbeitnehmerin nur unter Hinzuziehung eines externen Netzwerk-Administrators erhielt.
Das LAG hat herausgestellt, dass ein ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein bei Arbeitnehmern allgemein nicht besteht, wenn sie die arbeitgeberseitige Computeranlage zu privaten Zwecken auch in der Dienstzeit nutzen. Dies sei insbesondere auch deshalb der Fall, weil diese Frage bei jedem Arbeitgeber unterschiedlich geregelt sei und von einem generellen Verbot der privaten Nutzung der Computeranlage während der Arbeitszeit nicht ausgegangen werden könne. Wenn der Arbeitgeber deshalb die private Nutzung der betrieblichen Computeranlage nicht dulden will und dies als kündigungsrelevanten Tatbestand ansieht, dann bedarf es nach der Entscheidung des LAG Köln einer klaren Definition der Nutzungsmöglichkeiten bzw. -verbote durch den Arbeitgeber, der hierdurch die zunächst ihm obliegende Organisationsaufgabe erfüllt. Wenn solche eindeutigen Hinweise und Regelungen zur privaten Nutzung der betrieblichen Computeranlage nicht bestehen, setzt die Kündigung auch bei umfangreicherer privater Nutzung der betrieblichen Computeranlage regelmäßig die Erteilung einer Abmahnung voraus, um dem Arbeitnehmer die Möglichkeit zu geben, sein Verhalten abzustellen.
Auch die in den privaten E-Mails enthaltenen beleidigenden Äußerungen über den Geschäftsführer des Arbeitgebers rechtfertigen eine Kündigung nicht, da die Arbeitnehmerin durch die Einrichtung des Passwortes geglaubt hat, hinreichenden Schutz vor der Kenntnisnahme durch den Arbeitgeber eingerichtet zu haben und ihr damit das Bekanntwerden ihrer negativen Äußerungen nicht zurechenbar war. In diesem Punkt unterschied sich der dem Urteil des LAG Köln zugrundeliegende Sachverhalt von dem Fall, den das BAG durch Urteil vom 1 0.10.2002 entschieden hatte. Das BAG hatte festgestellt, dass diffamierende und ehrverletzende Äußerungen über Vorgesetzte und Kollegen in vertraulichen Gesprächen unter Arbeitskollegen unter bestimmten Umständen eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses nicht rechtfertigen können. Der Arbeitnehmer darf in solchen Fällen nämlich regelmäßig darauf vertrauen, seine Äußerungen würden nicht nach außen getragen und hierdurch auch der Betriebsfrieden nicht gestört bzw. das Vertrauensverhältnis der Arbeitsvertragsparteien nicht zerstört (BAG, Urteil vom 10.10.2002 - 2 AZR 418/01). Diesen Schutz der Privatsphäre und auch der Meinungsfreiheit verliert derjenige Arbeitnehmer, der selbst die Vertraulichkeit des Gespräches aufhebt, so dass die Gelegenheit für Dritte, seine Äußerungen wahrzunehmen, ihm zurechenbar werde. Auch wenn das LAG Köln feststellte, dass ein verhaltensbedingter Kündigungsgrund nicht vorlag, endete das Arbeitsverhältnis der Parteien dennoch auf der Grundlage des hilfsweise gestellten Auflösungsantrags gemäß § 9 KSchG. Da die Arbeitnehmerin sich währ end des Prozesses von ihren Äußerungen zu der Person des Geschäftsführers nicht distanziert hatte und auch keine Entschuldigungserklärung abgab, ging das LAG Köln zu Recht davon aus, dass mit einer vertrauensvollen und fruchtbaren Zusammenarbeit der streitenden Arbeitsvertragsparteien künftig nicht mehr zu rechnen und deshalb der seitens des Arbeitgebers gestellte Auflösungsantrag gerechtfertigt war.